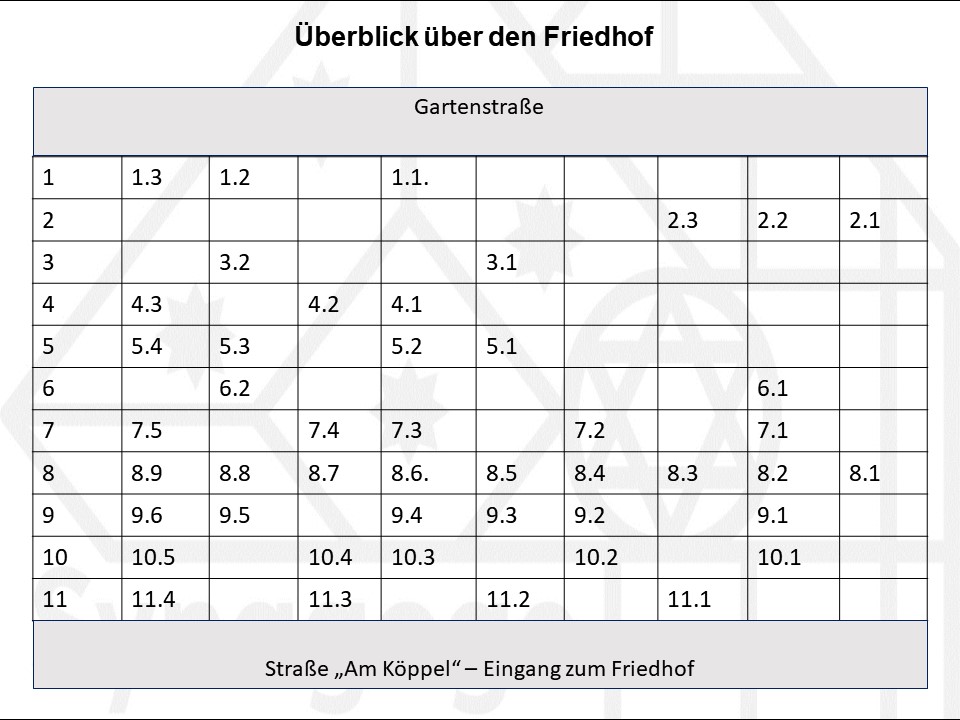Foto entnommen: 850 Jahre Vöhl, 1994
 Foto und Zitat: Freilichtmuseum Hessenpark
Foto und Zitat: Freilichtmuseum Hessenpark
Erbaut: zwischen 1694 und 1700
Abgebaut: 1978
Wiedererrichtet: 1995 bis 1998 (Außenbau)
Das am Straßengiebel reich verzierte Gebäude aus der Gemeinde Vöhl im heutigen Landkreis Waldeck-Frankenberg gehört vom Bautyp zu den regional verbreiteten sogenannten Diemelland-Häusern. 1704 wird es schriftlich erstmalig als Haus zum Fruchtmagazin erwähnt. Es war Verwaltungsbüro und Lagerhaus für die Naturaleinnahmen des herrschaftlichen Amtes. Als Frucht-speicher wurde es bis 1833 genutzt. Im gleichen Jahr kaufte es der Pferdehändler Joseph Kugelmann. Eine knapp sechs Jahrzehnte währende Nutzung als Wohnhaus mit wechselnden Besitzer- und Mietparteien begann. Über mehrere Jahre befand sich zudem eine Schuhmacherwerkstatt im Erdgeschoss. 1886 erwarb der Schmied und Eisenwarenhändler Friedrich Schmal II. das Gebäude. Die Schmiede der Familie Schmal war bereits 1843 auf dem Nachbargrundstück erbaut worden. Ab 1890 war das Haus ausschließlich Werkstatt für Landmaschinen und Lager für Schmiedematerialien und Verkaufsgegenstände. Das Warenangebot war sehr breit gefächert: Es gab Herde, Öfen und Fahrräder ebenso wie landwirtschaftliches und handwerkliches Gerät sowie Haushaltswaren. Der Eisenwarenhandel wurde von Familie Schmal bis zum Abbau des Gebäudes 1978 betrieben.
Darstellung und Einrichtung des Hauses sollen als Lagerhaus für Eisenwaren im Zeitschnitt von 1953 erfolgen.
Ende Zitat.
Das vormals hier stehende Haus wurde im Jahre 1978 abgebaut und in den 90-er Jahren wieder im Hessenpark aufgebaut.
Informationen zu den Personen und deren Angehörigen erhalten Sie über den Stammbaum: Familie Kugelmann, Isaak
 © Walter Schauderna
© Walter Schauderna

 Foto: Karl-Heinz Stadtler
Foto: Karl-Heinz Stadtler Foto: Karl-Heinz Stadtler
Foto: Karl-Heinz Stadtler





 Foto entnommen: 850 Jahre Vöhl, 1994
Foto entnommen: 850 Jahre Vöhl, 1994 Foto und Zitat:
Foto und Zitat: 










 © Kurt-Willi Julius
© Kurt-Willi Julius